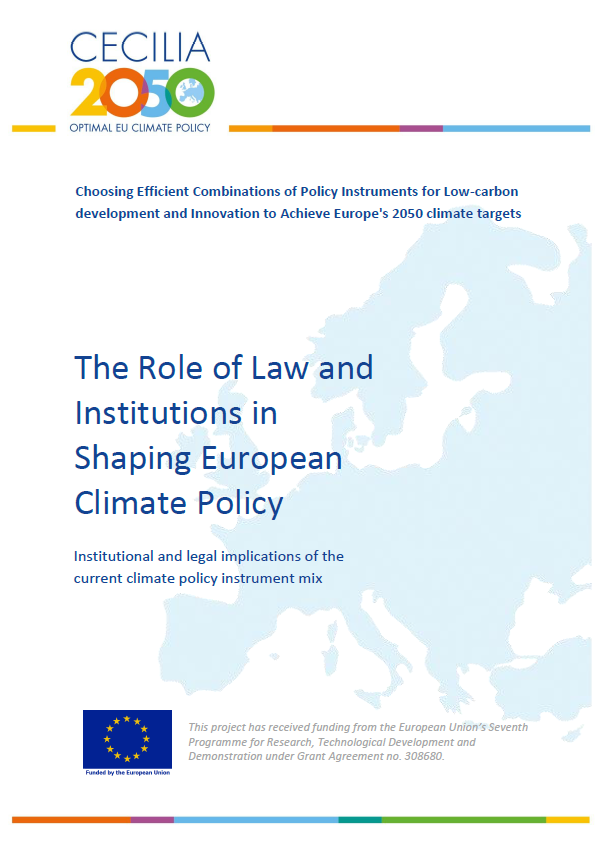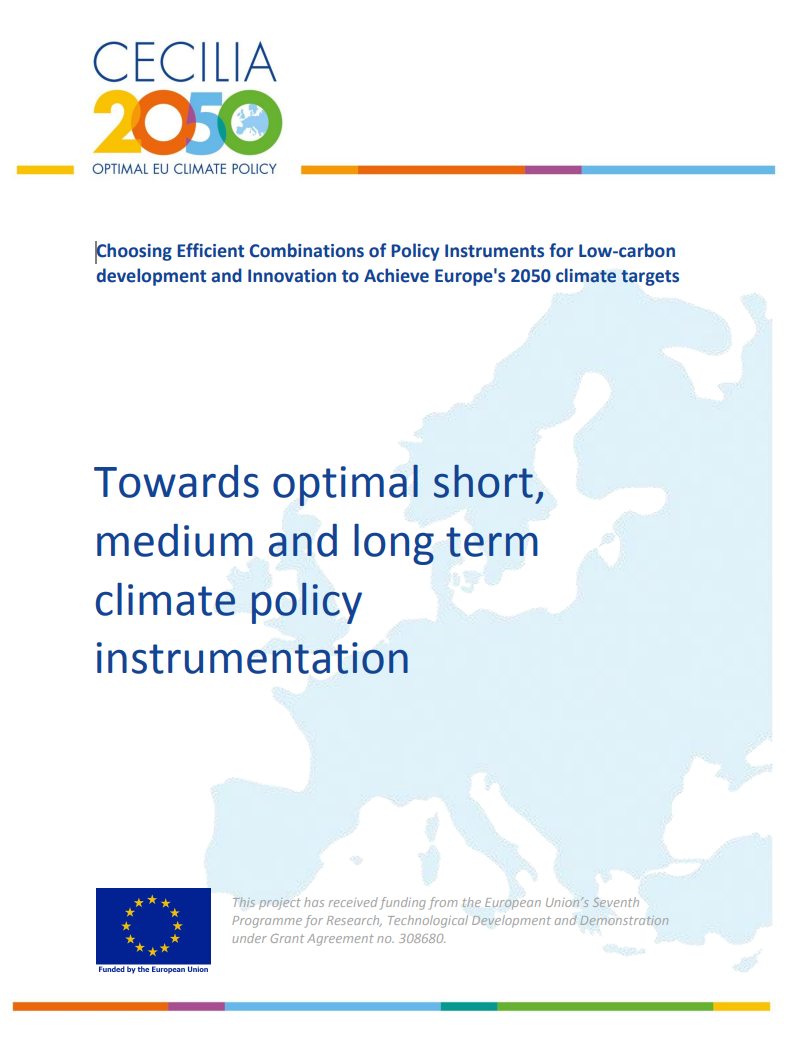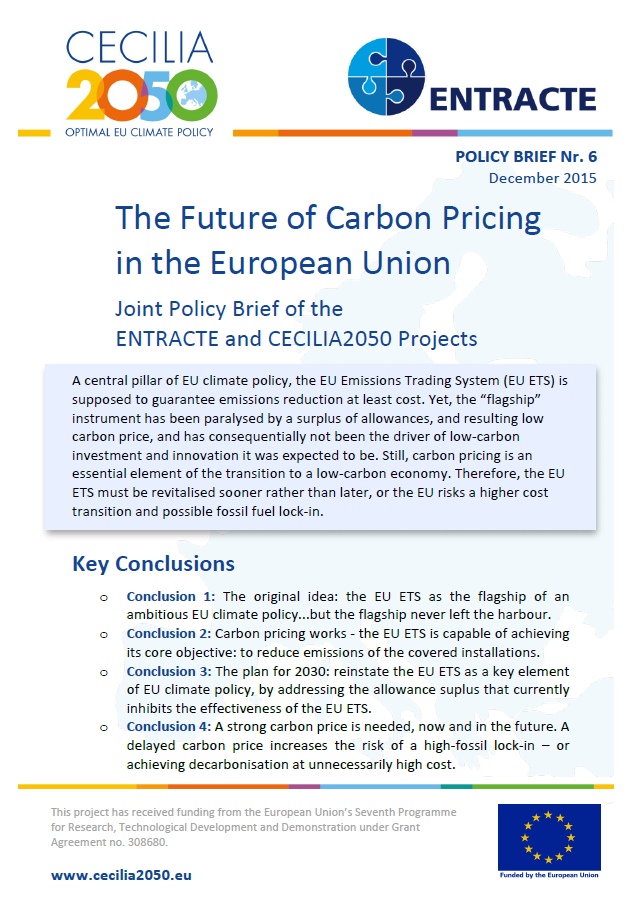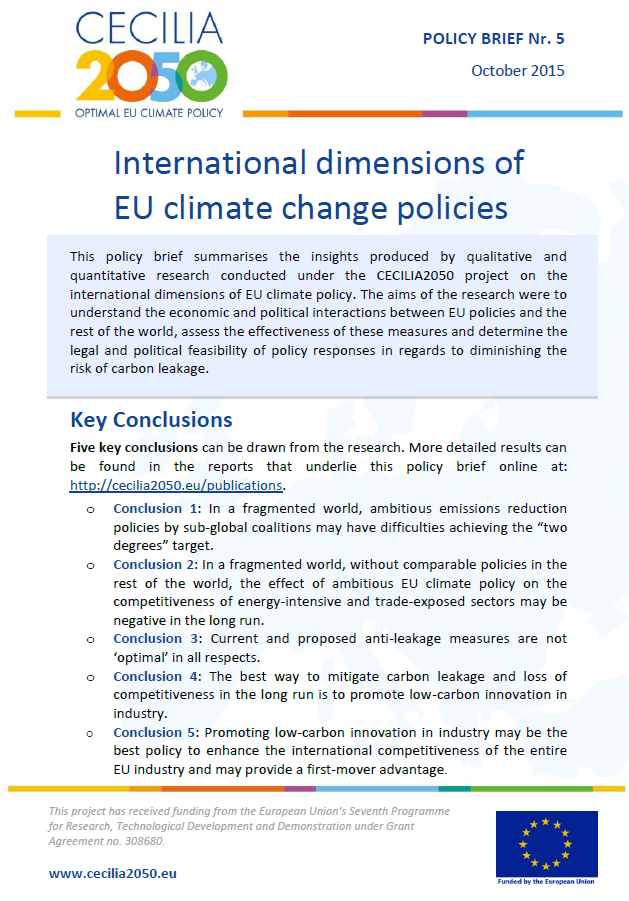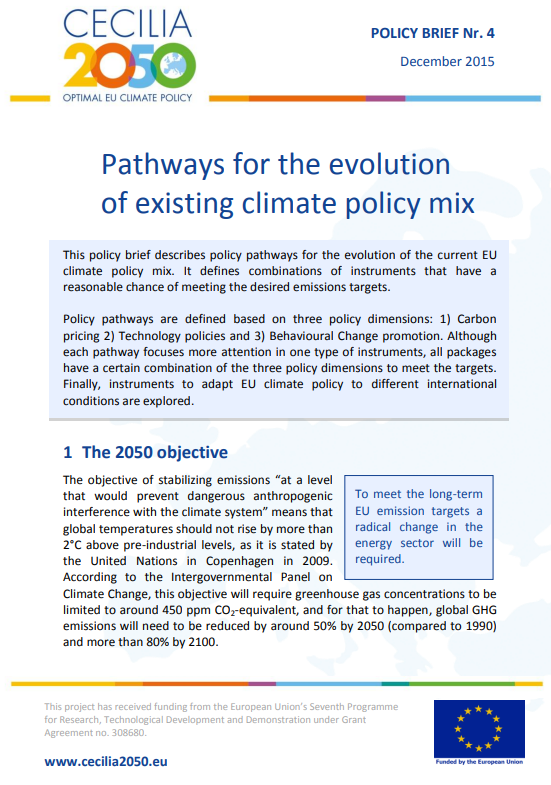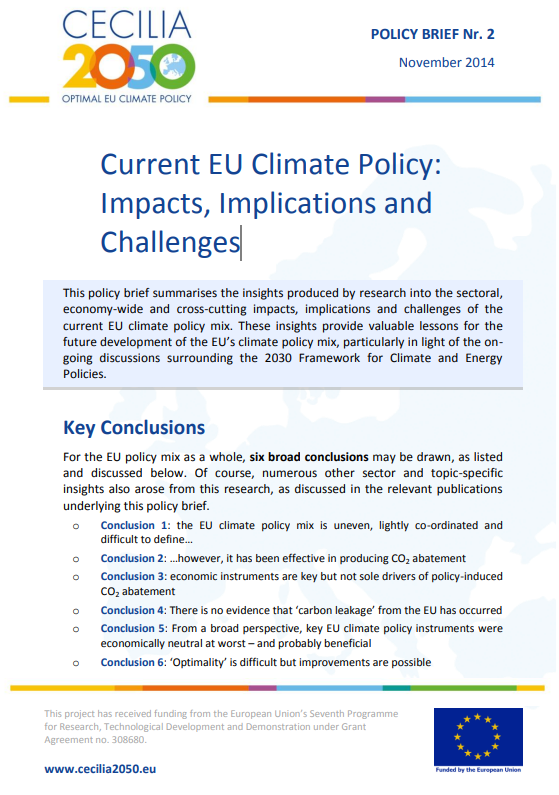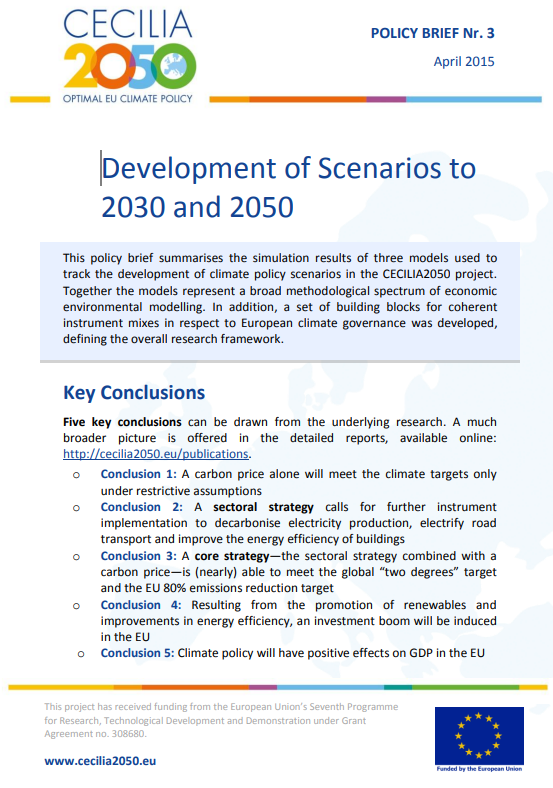The Role of Law and Institutions in Shaping European Climate Policy
Institutional and legal implications of the current climate policy instrument mix
- Publikation
- Zitiervorschlag
Mehling et al. 2013. The Role of Law and Institutions in Shaping European Climate Policy. Institutional and legal implications of the current climate policy instrument mix. CECILIA2050 WP2 Deliverable 2.9. Berlin: Ecologic Institute.
Dieser Bericht bietet einen konzeptionellen, rechtlichen und institutionellen Überblick über die Europäische Union sowie über drei Mitgliedstaaten – Deutschland, Polen und das Vereinigte Königreich –, um markante Regulierungsansätze herauszustellen. Die drei Mitgliedstaaten wurden aufgrund ihrer gegensätzlichen Merkmale ausgewählt: Sie repräsentieren unterschiedliche Rechtssysteme, unterschiedliche Governance-Ansätze und unterschiedliche historische Haltungen gegenüber bestimmten Regulierungsansätzen. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrem Gesamtkonzept für die Klimapolitik, sondern haben auch unterschiedliche Instrumente gewählt, um die EU-Klima- und Energievorschriften zu erfüllen. Während das Vereinigte Königreich und Deutschland „alte“ Mitgliedstaaten sind, ist Polen einer der „neuen“ Mitgliedstaaten der EU.
Angesichts dieser Vielfalt (und der Entwicklung) der klima- und energiepolitischen Ansätze in den jeweiligen Ländern lassen sich aus dem Arbeitspaket bestimmte Trends und Muster ablesen. Politischen Entscheidungsträgern kann geraten werden, diese Aspekte zu berücksichtigen:
- Die Wirtschaftstheorie liefert nützliche Kriterien wie Umweltverträglichkeit und Kosteneffizienz als Richtschnur für die Wahl klimapolitischer Instrumente. In der Praxis spielen solche abstrakten Kriterien jedoch nur eine begrenzte Rolle und müssen durch politische, rechtliche und institutionelle Überlegungen ergänzt werden, um die Wahl der Instrumente in der Praxis zu verstehen.
- Die Anwendung neuer Regulierungsansätze kann zu rechtlichen Konflikten führen. Die Beilegung solcher Konflikte ist mit wirtschaftlichen und möglicherweise politischen Kosten verbunden und kann die Umsetzung einer Verordnung verzögern. Andererseits können die daraus resultierenden Gerichtsurteile Klarheit für künftige Regulierungen schaffen, da sie die Grenzen und Möglichkeiten der neuen Ansätze definieren.
- Je nach der Verwaltungsgliederung einer Regierung können verschiedene Stellen (z. B. Ministerien) für unterschiedliche Teile einer Politik zuständig sein - dies gilt insbesondere für die Klimapolitik, da sie so breit gefächert ist. Eine solche Aufteilung der Zuständigkeiten kann zu institutionellen Konflikten führen, die das Tempo und die Kohärenz der Umsetzung nationaler politischer Ziele oder EU-Richtlinien behindern.
- Die subnationale Ebene ist für die Umsetzung von Vorschriften in einigen Mitgliedstaaten unerlässlich.
- Verfahrensrechtliche Erwägungen sind wichtig - die Art und Weise, wie Verordnungen verabschiedet werden (z. B. Mehrheitsbeschluss statt Einstimmigkeit), kann den politischen Willen behindern, politische oder wirtschaftliche Kosten zu tragen, z. B. bei der Umsetzung einer EU-Richtlinie.