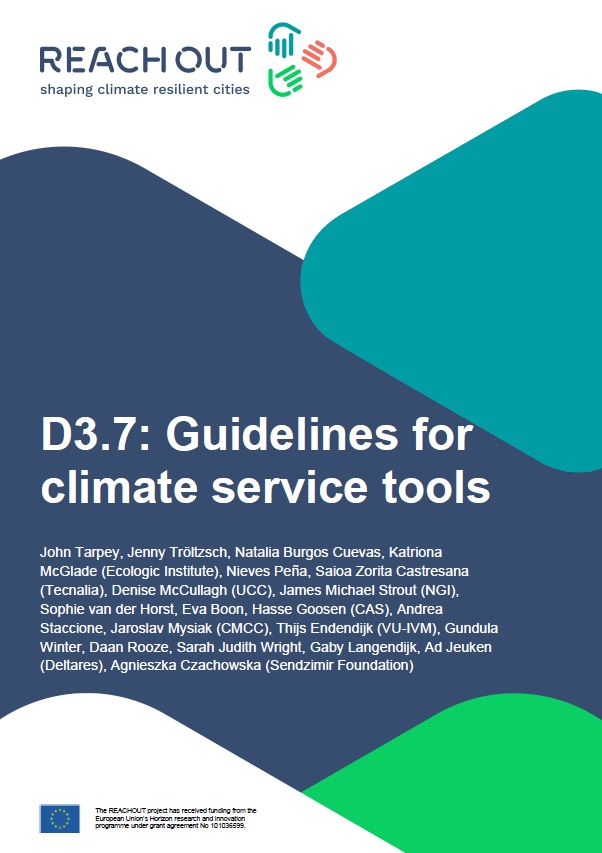© PwC EU Services, 2025
Städtische Hitzebelastung reduzieren
Strategien aus europäischen Städten
- Veranstaltung
- Datum
-
- Ort
- Online, Italien
- Aktive Rolle
Am 14. April 2025 kamen 80 Vertreter:innen aus Stadtverwaltungen, Forschung und Planung zusammen, um Strategien zur Minderung des Urban Heat Island (UHI) Effekts zu diskutieren. Im Fokus standen Beispiele aus Athen, Mailand und Wien, die zeigten, wie unterschiedliche Städte auf lokaler Ebene wirksame Maßnahmen umsetzen, analysieren und weiterentwickeln.
Praxisbeispiele aus Athen, Mailand und Wien
Athen präsentierte einen beteiligungsorientierten Ansatz, der auf Jugendengagement und innovative Kommunikationsmittel wie Virtual Reality setzt. Über Projekte wie ARSINOE und REACHOUT wurden "Living Labs", eine Youth Climate Assembly und ein öffentliches Klimaboard initiiert. Der Posten eines Chief Heat Officer erwies sich als wichtiges Element zur ressortübergreifenden Koordination. Trotz begrenzter Ressourcen konnte durch gezielte Ansprache und Beteiligung Wirkung erzielt werden.
Mailand stellte eine strukturierte, datenbasierte Strategie vor, bei der UHI-Minderung in den Luft- und Klimaplan der Stadt integriert ist. Ein Beispiel ist das Projekt School Oasis, das Schulhöfe in öffentlich zugängliche grüne Räume umgestaltet. Hitzerisikokarten helfen bei der Priorisierung von Maßnahmen. Die Zusammenarbeit mit regionalen Behörden und der Zugang zu offenen Daten sind zentrale Bestandteile des Konzepts.
Wien verfolgt einen regulatorisch gestützten Ansatz, der auf langjährige Erfahrung und technische Analysen zurückgreift – von mikroklimatischen Simulationen bis hin zu Bauvorschriften. Seit Veröffentlichung der UHI-Strategie 2015 wurden ein Klimaleitfaden, ein Klimagesetz sowie verpflichtende Vorgaben zur Dach- und Fassadenbegrünung eingeführt. Öffentliche Förderungen, insbesondere im sozialen Wohnungsbau, sowie Beratungsangebote ergänzen den Maßnahmenkatalog.
Diskussion: Koordination, Wirkung und soziale Gerechtigkeit
In der Diskussion wurde deutlich, dass institutionelle Strukturen – etwa koordinierende Fachstellen wie die Chief Heat Officer in Athen oder spezialisierte Verwaltungseinheiten – die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen wesentlich erleichtern. Gleichzeitig ist Monitoring entscheidend, um systemische Wirkung zu erzielen und Maßnahmen zu evaluieren.
Auch soziale Aspekte wurden betont: Wien achtet auf kommerzfreie Nutzung neu geschaffener Grünflächen. Mailand analysiert Hitzebelastung auf Quartiersebene unter Einbezug lokaler Akteur:innen. Athen nutzt einen Sozialindex zur Priorisierung von Kühlmaßnahmen. Kommunikation, Teilhabe und gerechte Ressourcennutzung sind zentrale Erfolgsfaktoren.
Fachimpulse aus weiteren Städten
Ergänzt wurden die Fallbeispiele durch Beiträge aus Bilbao, Granollers, Rom und vom spanischen Forschungsinstitut TECNALIA:
- Bilbao stellte seine Umweltstrategie mit Fokus auf Hitze- und Überflutungsrisiken vor und sprach über die Bedeutung narrativer Kommunikation.
- Granollers berichtete über die Anwendung von Mikroklima-Analysen und Sensornetzwerken zur Wirkungsbewertung.
- TECNALIA (Efren Feliu Torres) erläuterte verschiedene Methoden zur Analyse städtischer Überhitzung und betonte die Notwendigkeit, Analysewerkzeuge eng an Entscheidungsprozesse zu koppeln.
- Rom präsentierte den Einsatz technischer Instrumente wie Hitzekarten zur Identifikation von Handlungsprioritäten sowie die Bedeutung der Arbeit auf verschiedenen Maßstabsebenen.
Einigkeit bestand darin, dass ressortübergreifende Zusammenarbeit, Zugang zu verlässlichen Daten und die Auswahl geeigneter Werkzeuge zentrale Herausforderungen darstellen. Auch der Bedarf an Indikatoren für grüne öffentliche Beschaffung wurde hervorgehoben.
Von führenden europäischen Städten lernen
Die Veranstaltung war Teil des Projekts "Climate Adaptation – The Urban Heat Island effect in the city of Rome", das durch das Technical Support Instrument – SG #REFORM der Europäischen Kommission finanziert wird. Er diente dazu, bewährte Praktiken und Erfahrungen zu sammeln, um die Entwicklung des städtischen Wärmeaktionsplans für die Stadt Rom zu unterstützen.