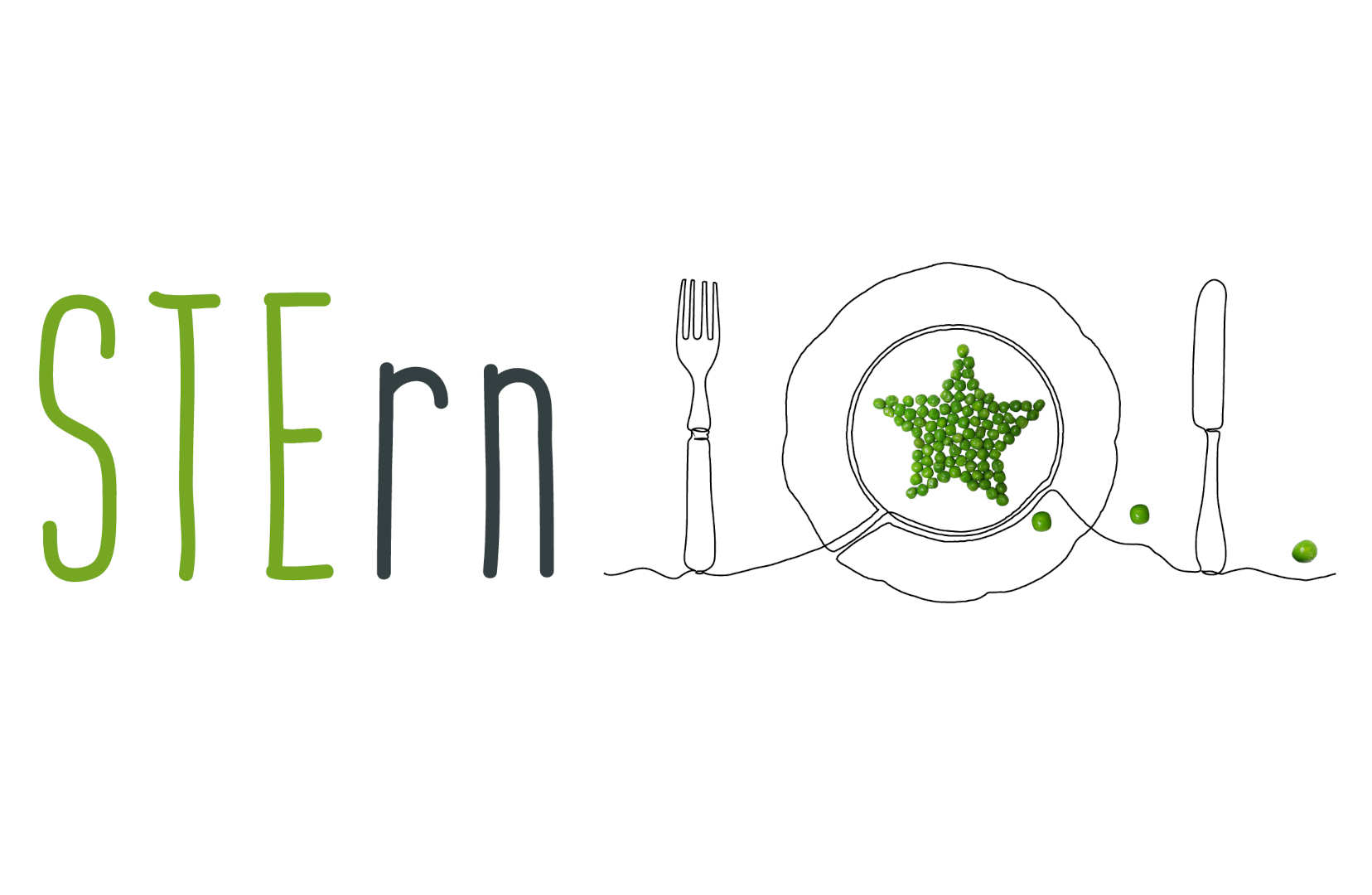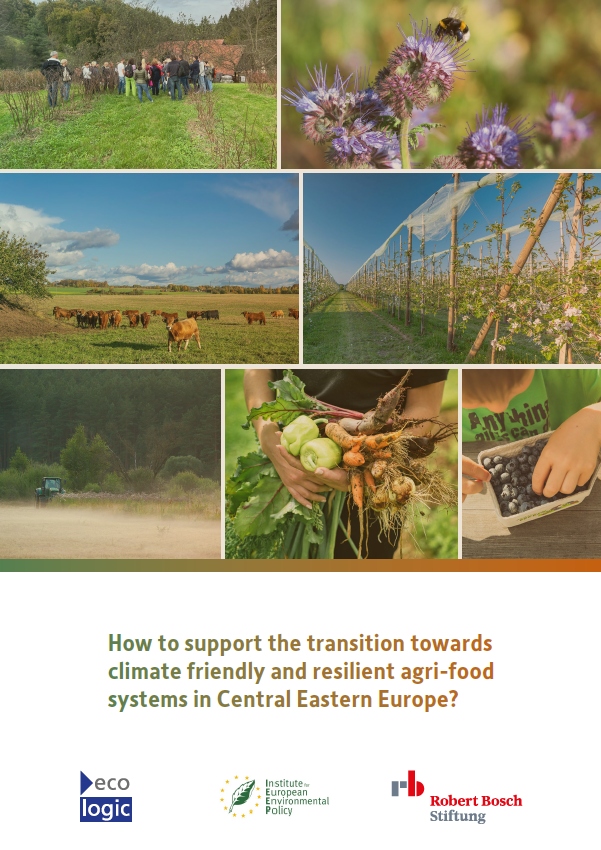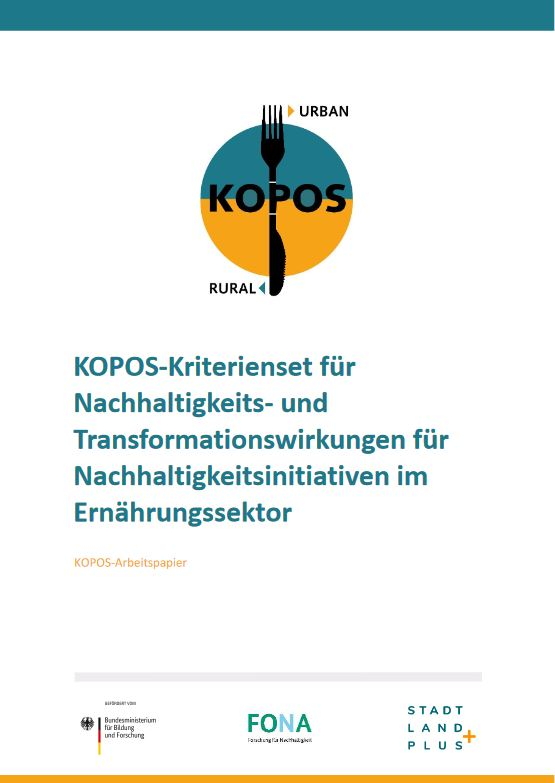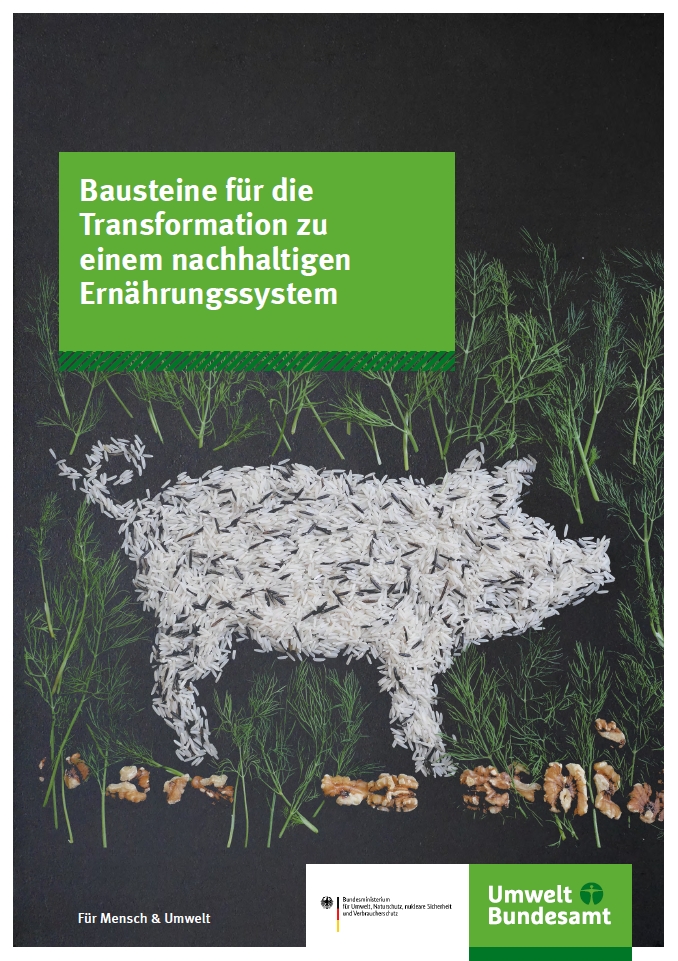Hamburg steht als wachsende Metropole mit begrenzten landwirtschaftlichen Flächen vor besonderen Herausforderungen: Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Flächenkonkurrenz und ein hoher Konsum tierischer Produkte belasten Umwelt und Klima. Globale Krisen wie Pandemien oder Kriege zeigen zudem die Fragilität internationaler Lieferketten und die Abhängigkeit von Importen.
Trotz urbaner Struktur spielt die Landwirtschaft mit rund 14.000 Hektar Nutzfläche und einem starken Gartenbau eine zentrale Rolle für das Stadtbild, die Lebensqualität und die regionale Versorgung. Doch ökonomischer Druck, unklare Hofnachfolgen, Fachkräftemangel und das anhaltende Höfesterben gefährden die langfristige Stabilität des Sektors – besonders in der städtischen Landwirtschaft.
Zudem ist Hamburgs Landwirtschaft besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels – wie steigende Wasserstände und Überflutungen, die vor allem Gartenbaubetriebe in den Vier- und Marschlanden bedrohen.
Eine zukunftsfähige Agrar- und Ernährungspolitik sollte daher ökologische, ökonomische und soziale Aspekte systemisch denken – mit tragfähigen Konzepten für artenreiche, klimaresiliente und wirtschaftlich stabile Betriebe, der Sicherung landwirtschaftlicher Flächen, neuen Ansätzen für die Stadt-Landwirtschaft sowie der Stärkung regionaler Wertschöpfung. Forschung, Kooperation und Vernetzung bilden dabei zentrale Grundlagen.
Zukunft Agrar+ 2045: Hamburgs Weg zur nachhaltigen und zukunftsfähigen Agrarwirtschaft
Mit "Zukunft Agrar+ 2045" hat die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) in Hamburg einen breit angelegten Transformationsprozess gestartet, um die Agrar- und Ernährungswirtschaft der Stadt nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen und eine Agrarstrategie zu entwickeln. Ziel ist es, Hamburg zu einer Modellregion für die Transformation der urbanen Agrarwirtschaft zu entwickeln.
Partizipativer Prozess für die Agrarstrategie
Am 4. März 2025 fiel der Startschuss: Über 100 Teilnehmende aus Verwaltung, Landwirtschaft/Gartenbau, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verbänden kamen zur Auftaktveranstaltung in Hamburg zusammen, um sich gemeinsam auf den Weg zu machen.
Im Zentrum steht ein partizipativer Entwicklungsprozess: Alle Akteure der Hamburger Agrarwirtschaft sind eingeladen, sich aktiv am Dialogprozess zu beteiligen, um ein integriertes Zukunftsbild für die Agrarwirtschaft bis 2045 zu entwickeln und daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten.
Die zukünftige Agrarstrategie wird eng mit anderen gesamtstädtischen Prozessen verzahnt, um Synergien zu schaffen und die Anschlussfähigkeit zu sichern.
Der Weg zur Agrarstrategie
Der Transformationsprozess gliedert sich in drei Phasen:
- Phase: Zielbild
Entwicklung eines integrierten Zielbilds für die Hamburger Agrar- und Ernährungswirtschaft 2045. - Phase: Handlungsfelder & Maßnahmen
Ableitung konkreter Strategien, Handlungsbedarfe und Maßnahmen zur Zielerreichung. - Phase: Strategie & Umsetzung
Veröffentlichung der Agrarstrategie und Start in die Umsetzungsphase.
Der Beteiligungsprozess bindet alle relevanten Akteur:innen ein, darunter landwirtschaftliche Betriebe/Gartenbaubetriebe, Fachämter der BUKEA, Berufs- und Gartenbauverbände, die Landwirtschaftskammer, Naturschutzorganisationen sowie städtische Fachbehörden, Bezirke und weitere Multiplikator:innen.
Alle Inhalte werden in einem dialogorientierten Prozess in Werkstätten und Beteiligungsformaten erarbeitet.
Termine
• 13. Juni 2025 – Werkstatt "Zielbild Agrarwirtschaft 2045", Schwerpunkte: Flächensicherung & Zugang zu Land; Klimaschutz, -anpassung & -resilienz; (Agrar)Landschaft & Biodiversität
• 16. Juni 2025 – Werkstatt "Zielbild Agrarwirtschaft 2045", Schwerpunkte: Regionale (Bio)Wertschöpfung; ökonomische Tragfähigkeit & neue Konzepte für Stadt, Landwirtschaft und Fachkräfte; Digitalisierung, Technik & Forschung
Weitere Termine und Beteiligungsmöglichkeiten folgen.
Beitrag des Ecologic Instituts
Das Ecologic Institut begleitet den Transformationsprozess für die Zukunft der Hamburger Agrarwirtschaft fachlich – in enger Zusammenarbeit mit dem Projektteam aus urban catalyst und Prof. Antje Stokman (HCU Hamburg).
Es entwickelt Vorschläge für Leitlinien, Ziele, Maßnahmen und Indikatoren als Grundlage für den partizipativen Strategieprozess. Fachliche Analysen werden dabei fortlaufend mit Perspektiven aus Praxis, Verwaltung, Verbänden und Wissenschaft rückgekoppelt.
Entlang zentraler Transformationspfade – wie Klimaschutz, Biodiversität, regionale Wertschöpfung, Zugang zu Land, ökonomische Tragfähigkeit, neue Konzepte für Stadt, Landwirtschaft und Fachkräfte sowie Digitalisierung und Forschung – bereitet das Ecologic Institut die strategischen Inhalte für Werkstätten und Beteiligungsformate auf. So entsteht eine zukunftsorientierte Agrarstrategie, die wissenschaftlich fundiert, breit getragen und praxisnah ist.